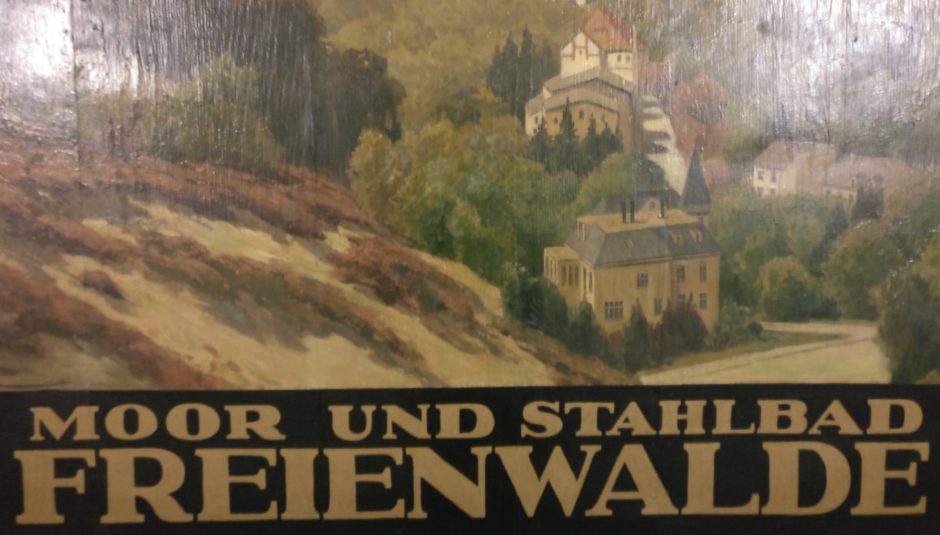Uwe Rada über die Zukunft des Oderbruchs und die vier Szenarien, die Kenneth Anders und Lars Fischer dazu entwickelt haben.
http://www.uwe-rada.de/themen/berlin_oderbruch.html
Im Auftrag von Brandenburgs Landwirtschaftsminister Dietmar Woidke (SPD) haben Anders und Fischer vier Szenarien für die Zukunft des Oderbruchs entwickelt. Drei der vier Prognosen ist gemeinsam, dass sie eine Absage sind ans „Weiter so“. Im Szenario „Intensivierung“ erobert die Biomasse das Oderbruch, schnellwachsende Weiden und „Chinaschilf“ ersetzen den bisherigen Anbau von Kartoffeln und Gemüse. Infolgedessen bricht der Tourismus ein, die Eisenbahnverbindungen werden eingestellt, Böden und Grundwasser sind mit Düngemitteln verseucht.
Nicht viel optimistischer ist das Szenario „Extensivierung“. Weil die Entwässerung der Niederungslandschaft zu teuer geworden ist, lässt die Landesregierung weite Teile des Bruchs vernässen. Weidewirtschaft und Fischerei erleben eine Renaissance. Um den rasanten Bevölkerungsverlust aufzuhalten, setzt die Landesregierung auf eine „Disneylandisierung“ des Oderbruchs. Auch der Naturschutz muss deshalb zurücktreten.
Die düsterste Prognose freilich hält das Szenario „Katastrophe“ bereit. Erneut kommt es zu einer Jahrhundertflut an der Oder. Anders als 1997 beschließt die Landesregierung jedoch, das Oderbruch aufzugeben und die Bevölkerung umzusiedeln. Doch auch die Bundeswehr kann nicht verhindern, dass zahlreiche Bewohner zurückkehren und wilde Siedlungen auf Subsistenzbasis gründen. Darüber hinaus rufen Aktivisten die „Freie Republik Oderbruch“ aus. Weil die Hochwasser jedes Jahr im Sommer und Winter das Bruch fluten, haben die Siedler ihre Häuser auf Warften errichtet – wie vor der Trockenlegung im 18. Jahrhundert.
Demgegenüber wirkt das Szenario „Kulturlandschaft“ beinahe harmlos. Um den Bevölkerungsschwund zu stoppen, vernetzen sich die Akteure und setzen auf Kulturtourismus. Sogenannte Raumpioniere sorgen für Innovation und die nötige Verjüngung, Deutsche und Polen basteln gemeinsam an regionalen Wirtschaftskonzepten. Selbst die Eisenbahnverbindung bleibt erhalten.
Aber auch das „Kulturlandschaftsszenario“ hat nicht verhindern können, dass zahlreiche Oderbrüchler auf die Barrikaden gingen. „Es scheint, als gäbe es Bemühungen aus verschiedenen Richtungen, den Grenzraum tatsächlich langsam aussterben zu lassen, indem unsere Region ständig nur schlechtgeredet wird“, klagt der Ortsbürgermeister von Neureetz; die ehrenamtliche Bürgermeisterin der Gemeinde Oderaue fordert in einem offenen Brief: „Nach 250 Jahren Kulturlandschaft Oderbruch werden wir nicht kneifen, wir werden uns nicht vertreiben lassen, und wir werden Menschen Mut machen, zu bleiben oder sich bei uns anzusiedeln.“
Die Reaktionen haben auch Kenneth Anders und Lars Fischer überrascht. „Offenbar leben die Menschen im Oderbruch ständig mit der Angst vor einer neuen Katastrophe. Und offenbar wird diese Angst permanent verdrängt“, erklärt sich Anders die Vorwürfe der Bürgermeister. Vor den Kopf stoßen wollten die Initiatoren des Projekts „Oderbruchfiktionen“ die Bewohner allerdings nicht. „Wir haben den Menschen vor Ort vier Jahre lang zugehört, haben ihre Positionen bei uns auf die Website genommen, haben versucht, den Dialog zu moderieren.“ Gerade auch weil es viele positive Reaktionen auf die Szenarien gegeben hat, ist Kenneth Anders überzeugt: „Die Antworten nach dem Schicksal einer Landschaft sind in der Landschaft selbst zu finden.“ Aber offenbar gibt es im Oderbruch, mutmaßt er, „nur wenig Bewusstsein dafür, welche Triebkräfte hier wirken.“
Für Anders dagegen ist klar, dass die Zukunft, die die Szenarien beschreiben, an der Oder längst begonnen hat. „Extensivierungs- und Intensivierungsstrategien gehen Hand in Hand“, hat er beobachtet. Tatsächlich ist das Oderbruch inzwischen Heimat für zahlreiche Raumpioniere wie auch Versuchsfeld für den Anbau von gentechnisch verändertem Mais. So wie die Trockenlegung des Oderbruchs im 18. Jahrhundert das Paradigma eines neuen Landschaftstyps hervorgebracht hat, zeichnet sich 250 Jahre später im Zeichen der Schrumpfungsdebatte ein neues Paradigma ab – das Nebeneinander verschiedener Nutzungsstrategien. So gesehen liegen Kenneth Anders und Lars Fischer mit ihren Szenarien ganz auf der Höhe der Debatte – ob die Bürgermeister das wahrhaben wollen oder nicht.